Kommentierung Normungsroadmap "Bauwerke"
Das DIN hat die Normungsroadmap „Bauwerke“ veröffentlicht: https://www.din.de/resource/blob/1010654/93b95fc2bf731d083fc9957443d6f344/entwurf-normungsroadmap-bauwerke-2024-data.pdf
Der Roadmapentwurf wurde federführend vom DIN-Sonderpräsidialausschuss Bauwerke, in dem auch BIngK-Präsident Dr. Bökamp Mitglied ist, erarbeitet. Ziel eines Roadmapprozesses ist es, Normungslücken und -bedarfe zu identifizieren und Normen möglichst strukturiert, anwenderfreundlich, transparent und vor allem praxisnah auszugestalten.
Schwerpunkte des aktuellen Entwurfs liegen auf den Themen Digitalisierung/BIM und Standards zu Klimaschutzmaßnahmen im Bauwesen. Darüber hinaus bleiben die Themen Standsicherheit, Brandschutz, Gesundheitsschutz, Barrierefreiheit, Schallschutz, Energieeinsparung, Technische Gebäudeausrüstung und Dienstleistungen wichtig.
Bis zum 15. März 2024 gibt die Möglichkeit zur Kommentierung der Normungsroadmap. Diese können per Mail und DIN-Kommentartabelle direkt beim DIN eingegeben werden. Tabelle, Mail-Adresse und weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/herausforderungen-klimaschutz-und-digitalisierung-wie-die-baubranche-gruener-werden-kann-1010722
WTA-Merkblätter jetzt auch im Online-Abo
Inhalte des Abonnements
Die Merkblätter der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA) erläutern praxisorientierte Vorgehensweisen zur Instandsetzung von Gebäuden im Bestand und zur Sanierung der historischen Bausubstanz. Die Merkblätter sind in folgende Referate unterteilt:
- Referat 1 Holz und Holzschutz
- Referat 2 Oberflächentechnologie
- Referat 3 Naturstein und Kunststein
- Referat 4 Bauwerksabdichtung
- Referat 5 Beton
- Referat 6 Bauphysik
- Referat 7 Tragverhalten und Schadensdiagnostik
- Referat 8 Fachwerk und Holzkonstruktionen
- Referat 9 Stahl und Glas
- Referat 10 Präventive Konservierung
- Referat 11 Brandschutz
Die Merkblätter sind auch innerhalb des Online-Abonnements nach Referaten gegliedert (auswählbar über Kategorien) und enthalten sowohl die Endversionen der Merkblätter als auch die Entwürfe.
Das Abonnement enthält alle aktuellen deutschen und englischen WTA-Merkblätter (momentan über 80 Stück).
Ihre Vorteile
- automatische Aktualisierung
- intuitive Bedienung
- bequeme Suchfunktion
- Kommentare, Bilder und Sprachnotizen (sogenannte Annotationen) möglich
- auch als App für Smartphone und Tablet verfügbar – ohne Zusatzkosten
- sowohl online als auch offline nutzbar
- bei Bedarf können Inhalte ausgedruckt werden
- Push-Nachrichten informieren über Neuigkeiten
Vor dem Abschluss des Abonnements können Sie die Anwendung anhand eines kostenfreien Merkblatts unverbindlich unter www.irb.fraunhofer.de/wta oder in der App »WTA-Merkblätter« testen (Annotationen eingeschränkt möglich).
Technische Details
Dank des Benutzerkontos benötigen Sie für die Desktop-Anwendung lediglich einen Webbrowser – die Nutzung ist also unabhängig vom Betriebssystem, eine Installation entfällt. Für die optimale Handhabung auf Tablet und Smartphone steht Ihnen die kostenlose App »WTA-Merkblätter« zur Verfügung.
Auszeichnung für die BAUSUBSTANZ – Shortlist-Platzierung
Deutsche Fachpresse vergibt Branchenaward
Die Bausubstanz ist die Fachzeitschrift für alle, die sich professionell mit der Instandhaltung, Sanierung, Restaurierung und Pflege alter Bauwerke beschäftigen. Sechsmal im Jahr bietet sie mit einer Mischung aus Reportagen über gelungene Sanierungsobjekte, der Vorstellung von Techniken, Baustoffen und Verfahren und wissenschaftlichen Beiträgen Neues, Bewährtes und Wichtiges aus dem weiten Feld der Bausanierung.
Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für den fachübergreifenden Ansatz und das Bestreben, auch technische Sachverhalte qualitätvoll und ansprechend zu vermitteln.
»Unser Dank geht an die Autorinnen und Autoren und unsere Partner, insbesondere die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA, ohne deren Zutun die Zeitschrift nicht in dieser Form möglich wäre.«, so Chefredakteur Thomas Altmann.
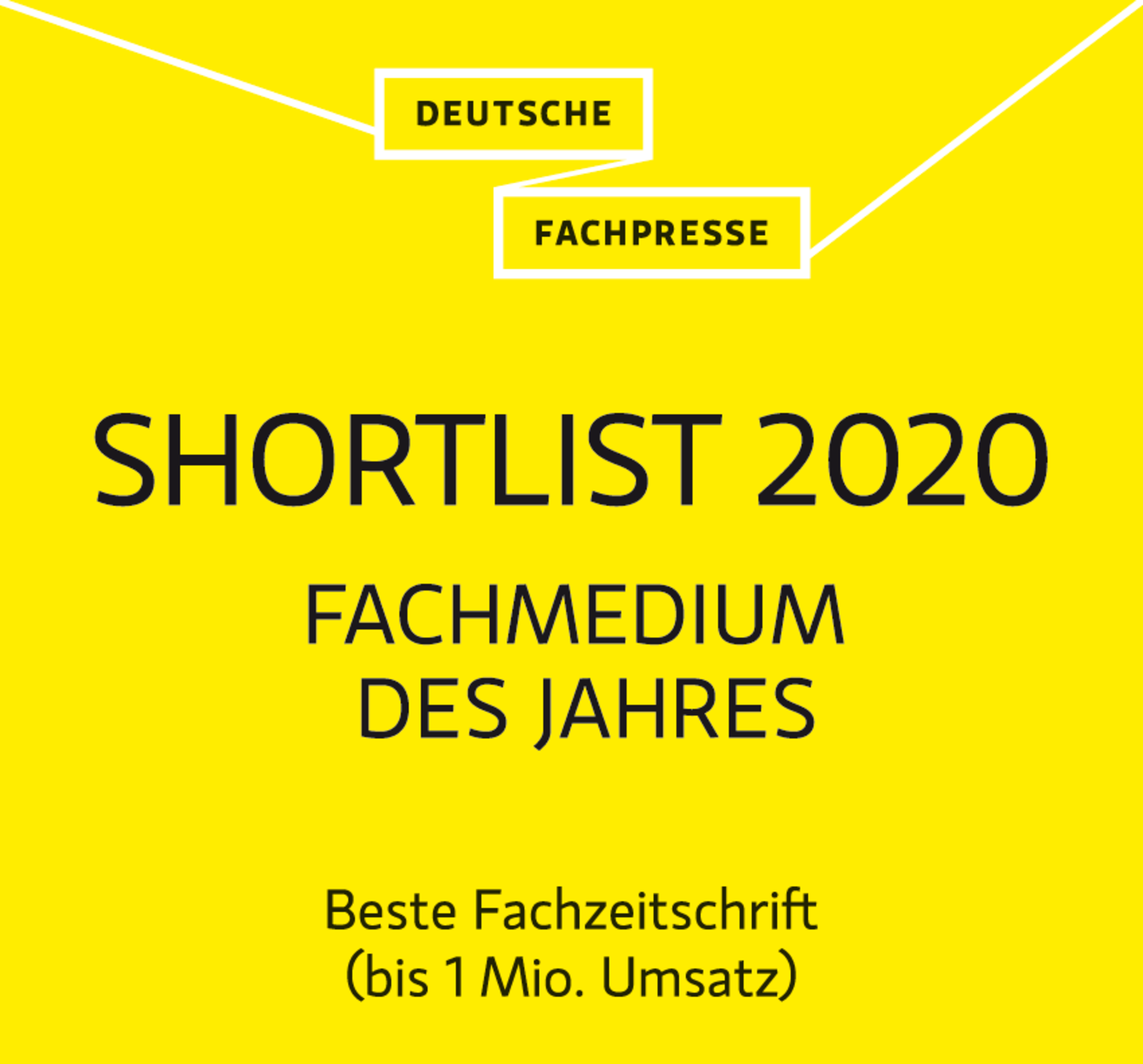
Mit dem Award zeichnet die Deutsche Fachpresse einmal jährlich die besten Fachmedien des Landes in insgesamt acht Kategorien aus. Ausgewählt werden sie in einem zweistufigen Bewertungsverfahren mit Vor- und Hauptjury. Die Jurys setzen sich aus Vertretern der Wirtschaft, Experten aus B2B-Agenturen, Hochschulen und Fachmedienhäusern zusammen. Gewürdigt werden mit dem Award Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die beispielhaft für die vielen herausragenden Informationsangebote aus Fachmedienhäusern in Deutschland stehen. Zugleich zeigt der Award, welchen Beitrag Fachmedien als Gattung für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft leisten.
Bernd Adam, Geschäftsführer der Deutschen Fachpresse: »Wir freuen uns mit den Siegern und gratulieren ihren Teams zu dieser preiswürdigen Leistung. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig zu zeigen, was Fachmedien für ihre Leser, Nutzer und Werbekunden leisten. Die Jury hatte wieder einen anspruchsvollen Auswahlprozess zu meistern, das machen auch die starken Shortlist-Platzierungen deutlich. Kreativität, Innovationskraft, inhaltlicher Anspruch, Verlässlichkeit und konsequente Kundenorientierung zeichnen unsere Sieger aus.«
Urteil des OLG Hamm zur Anwendung der DIN 18195-6 bzw. DIN 18533
In der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres gab es in Fachkreisen große Irritationen, die durch das problematisches Urteil des OLG Hamm (Urteil des OLG-Hamm vom 14.08.2019 - 12 U 73/18, PMBC im Übergang auf Bauteile aus WU-Beton in DIN 18195-6 bzw. DIN 18533) hervorgerufen wurden.
Das noch nicht rechtskräftige Urteil berührt m. E. die Grundsätze der Beratung und Veröffentlichung von Normen durch die Arbeitsausschüsse des DIN auf der Basis der Regelungen von DIN 820. Die Reaktion des DIN auf dieses Urteil kann sowohl für Bausachverständige als auch für die Bauwirtschaft allgemein und für die Arbeit an den in Fachkreisen hochgeschätzten WTA-Merkblättern maßgebliche Auswirkungen für die Bedeutung von DIN-Normen haben, die aufgrund ihrer Entstehung die Vermutung für sich haben, als allgemein anerkannte Regel der Technik zu gelten.
Zwischenzeitlich wurde vom DIN und dem für die DIN 18533 zuständigen Arbeitsausschuss das Thema "Kombinationsabdichtung mit PMBC am Übergang auf WU-Betonkonstruktionen" in Bezug auf das Urteil des OLG Hamm überprüft und in einem internen Audit die Entstehung noch einmal im Detail geklärt. Das DIN hat hierzu eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Die Stellungnahme stützt die Argumentation von Experten und ist im Hinblick auf die Diskussion in der Fachöffentlichkeit, wie mit dem Urteil umzugehen ist, ein wichtiger Baustein. Sie dient auch dazu, bei der Anwendung auf den Baustellen und bei Gericht weitere Irritationen zu vermeiden.
